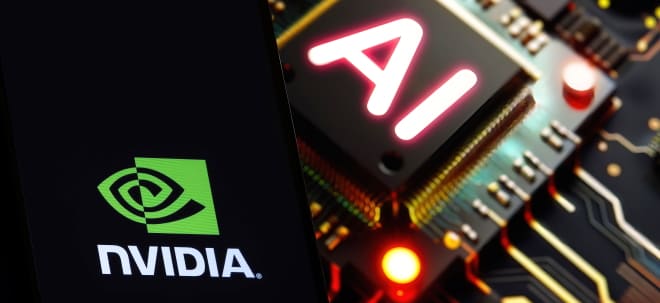Die Zeit läuft
Die Volksrepublik China ist führend in Zukunftsindustrien wie Batterietechnologie und E-Mobilität. In Teilen der Halbleiterindustrie hat das Land bereits das Niveau der EU und der USA erreicht. Im Maschinenbau, lange das Kronjuwel des deutschen Mittelstands, könnte China Europas größte Volkswirtschaft schon in fünf Jahren überholen. Diese Entwicklungen sind längst erkannt und haben eine Vielzahl industrie- und innovationspolitischer Initiativen in Europa, insbesondere in Deutschland, angestoßen.Wichtig ist, die strategische Bedeutung dieser Zukunftsindustrien klar zu erkennen und zu diskutieren. So bezweifelt niemand, dass eine Unterbrechung der Halbleiterlieferketten die Automobilproduktion in Europa zum Erliegen bringen würde. Und Batterien finden sich nicht nur in zivilen Pkw, sondern ebenso in militärischen Drohnen, die derzeit über den Schlachtfeldern der Ukraine eingesetzt werden.Die strategische Bedeutung der Biotechnologie – ein weites Feld, das von der Pharmaindustrie über medizinische Geräte bis hin zu agrarwissenschaftlichen Anwendungen wie der Entwicklung pestizidresistenter Pflanzen reicht – ist im europäischen politischen Diskurs bislang kaum erkannt. Das muss sich ändern, zumal die EU-Kommission im kommenden Jahr den EU Biotech Act vorlegen will, mit dem Europa in diesem Zukunftssektor wettbewerbsfähiger werden soll. Der Blick nach China zeigt allerdings, dass Europa die Biotechnologie viel ernster nehmen muss.Im Jahr 2024 skizzierte Xi Jinping vor Mitgliedern der Chinesischen Akademie der Wissenschaften die Rolle von Technologie – darunter auch Biotechnologie – in der globalen Ordnung. Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Biotechnologie, so Xi, lösten eine Kettenreaktion von Veränderungen aus. Die Welt befinde sich in einem Wandel, wie es ihn seit einem Jahrhundert nicht gegeben habe. Die wissenschaftlich-technische Revolution sei eng mit dem Großmächtewettbewerb verknüpft, und der Hightech-Sektor habe sich zum zentralen Schlachtfeld des internationalen Wettbewerbs entwickelt, das die globale Ordnung und die Entwicklungslandschaft grundlegend verändere. Aus seiner Sicht steht Biotechnologie damit auf einer Stufe mit jenen Technologien, die in Europa und Deutschland inzwischen als strategisch relevant gelten. In China spiegelt sich diese Erkenntnis in verschiedenen politischen Initiativen wider.Aus der einstigen Abhängigkeit Chinas von ausländischen Herstellern sind Branchen hervorgegangen, in denen das Land inzwischen Weltmarktführer ist.Die strategische Begründung stützt sich auf drei Elemente: auf die Absicherung von Lieferketten und den Drang nach Selbstständigkeit in China, auf die Rolle von Zukunftstechnologien als ökonomischer Wachstumsmotor und auf die sicherheitspolitische Perspektive auf medizinische Daten und deren Schutz. Entsprechend zählt die Biomedizin zu den zehn Sektoren, die im Programm Made in China 2025 aufgeführt sind. Diese Strategie, 2015 veröffentlicht, sorgte für Aufsehen, da sie für chinesische Unternehmen feste Marktanteile im eigenen Land vorsah – besonders im Bereich biomedizinischer Anwendungen und medizinischer Geräte wie etwa Röntgenmaschinen. Nachdem europäische Firmen über Jahre wachsende Umsätze auf dem chinesischen Markt erzielt hatten, führte die bevorzugte Behandlung einheimischer Anbieter bei der öffentlichen Beschaffung, etwa durch Krankenhäuser, zu geopolitischen Spannungen. Die EU reagierte mit Ausgleichszöllen, die China zuletzt beim EU-China-Gipfel im Juli erfolglos zur Sprache brachte.Aus der einstigen Abhängigkeit Chinas von ausländischen Herstellern sind Branchen hervorgegangen, in denen das Land inzwischen Weltmarktführer ist – nicht zuletzt, weil sich chinesische Unternehmen zunehmend global positionieren, auch in Europa. Im politischen Diskurs in Peking ist dabei vom Go Global-Ansatz die Rede.Die Abhängigkeit Europas von Importen in der Arzneimittelproduktion ist dagegen seit Langem bekannt. Einer von der EU-Kommission beauftragten Studie zufolge stammen rund 90 Prozent bestimmter traditioneller Medikamente, darunter viele Antibiotika, aus Drittstaaten – vor allem aus China und Indien. Mit dem geplanten EU Critical Medicines Act will die Europäische Union dieser Abhängigkeit entgegenwirken und die Versorgungssicherheit durch mehr Eigenproduktion sowie diversifizierte Lieferketten stärken.Nicht nur die Produktion und die sichere Lieferung weit verbreiteter Medikamente ist ein fundamentaler Pfeiler der deutschen Wirtschaft und Voraussetzung für eine widerstandsfähige Gesellschaft in Krisenzeiten. Auch die nächste Generation von Arzneimitteln muss diese Sicherheit künftig gewährleisten – dafür sind Investitionen nötig.Doch nach Jahren steigender Biotech-Investitionen in Deutschland kam es in diesem Jahr zu einer abrupten Kehrtwende: Anfang des Jahres sind die Investitionen hierzulande stark eingebrochen.China legt nach Jahren kontinuierlicher Investitionen ein enormes Tempo vor. Im vergangenen Jahr entfiel etwa ein Drittel aller Lizenzdeals für Medikamente auf chinesische Unternehmen. Dabei geht es um Präparate, die die frühe klinische Phase bereits überwunden haben und nun für Weiterentwicklung oder Marktreife infrage kommen. Noch vor wenigen Jahren spielten solche Geschäfte in China kaum eine Rolle. Inzwischen greifen auch deutsche Unternehmen auf diese Innovationskraft zurück: So erwarb Bayer Anfang dieses Jahres von der chinesischen Firma Suzhou Puhe eine Lizenz für einen Wirkstoff gegen Krebs.China legt nach Jahren kontinuierlicher Investitionen ein enormes Tempo vor.Im medizinischen Bereich werden auch in China Gesundheits- und Genomdaten als staatliche Ressourcen eingestuft. Im Rahmen der Human Genetic Resource Management-Regeln gelten sie als Bestandteil der nationalen Sicherheit. Ein Transfer ins Ausland ist daher nur nach einem besonderen Verfahren erlaubt. Seitdem zwischen 2021 und 2023 Vorgaben verschärft wurden, klagen Forschende zunehmend über Hindernisse bei der internationalen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik. So sieht eine 2023 vom chinesischen Wissenschaftsministerium erlassene Regelung für die Verwaltung genetischer Daten vor, dass sogenannte „wichtige genetische Gruppen“ einer nationalen Sicherheitsprüfung unterzogen werden. Welche Kriterien dieser Einstufung zugrunde liegen, ist schwer zu beurteilen.Während in Europa beim Umgang mit medizinischen Daten vor allem der Schutz der Privatsphäre im Vordergrund steht, betrachtet China sie vorrangig durch die Brille der nationalen Sicherheit. Biotechnologie ist dort Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts.Aus diesen drei Aspekten ergibt sich ein Gesamtbild, das den Handlungsdruck im Bereich Biotechnologie deutlich erhöht. Europa – und insbesondere Deutschland – haben die Chance, die Zukunft dieser Branche mitzugestalten. Dafür braucht es jedoch nicht nur einen klaren Blick auf die eigenen Schwächen, sondern auch auf die Stärken anderer Länder wie China.Ein solcher Blick fehlt bislang völlig: Zum Auftakt der Beratungen über den Biotech Act organisierte die EU-Kommission im Frühjahr 2025 einen Call for Evidence. Zwischen Mai und Juni gingen insgesamt 225 öffentlich zugängliche Stellungnahmen ein – von einzelnen Forschenden, von Hochschulen und von Industrieverbänden. Auffällig ist jedoch, dass keine einzige dieser Eingaben auf die rasanten Entwicklungen in der Volksrepublik China einging.Gerade dieser blinde Fleck zeigt, wie sehr Europa Gefahr läuft, die Dynamik in China zu unterschätzen. Dabei entscheidet die Biotechnologie zunehmend über Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und nationale Sicherheit. Mit dem geplanten Biotech Act will die EU zwar ihre Position stärken, doch ohne den Blick über den Kontinent hinaus bleibt sie auf halbem Weg stehen. Will Europa die Zukunft in diesem Schlüsselbereich mitgestalten, muss es die Entwicklungen in China mit derselben Ernsthaftigkeit betrachten, wie es Peking selbst längst tut.Weiter zum vollständigen Artikel bei IPG Journal
Quelle: IPG Journal