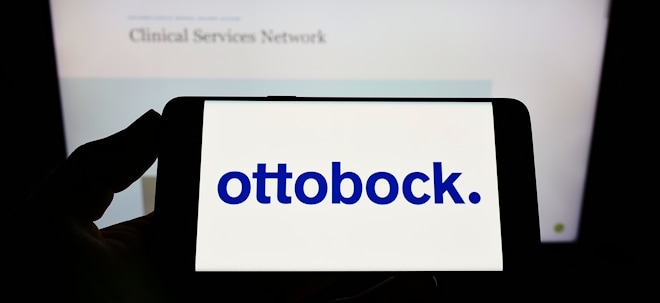Zu früh zum Jubeln
Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hat es dieser Tage schwer: Zum einen wächst der Druck aus Washington, endlich entschiedener gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen. Zum anderen lässt sich die Verstrickung ranghoher Mitglieder ihrer linksnationalistischen Morena-Partei in eben diese kriminellen Machenschaften nicht länger vertuschen. Eine gute Nachricht aber konnte sie verkünden: 13,4 Millionen Mexikanerinnen und Mexikaner haben in den vergangenen sechs Jahren die Armut hinter sich gelassen. Laut dem Statistik-Institut INEGI ist die Armutsquote damit von 41,9 auf 29,6 Prozent der Bevölkerung gesunken.Das ist eine Trendwende. In den vergangenen 30 Jahren seit Inkrafttreten des Freihandelsabkommens mit den USA und Kanada hat sich Mexiko zwar vom Agrarland und Rohstoffexporteur zu einem Manufaktur- und Dienstleistungshub entwickelt. Doch die anhaltend hohe Armut hatte sich nicht senken lassen. Hauptgrund dafür war die mächtige Wirtschaftslobby, die solche Vorhaben blockierte, um weiterhin von Niedriglöhnen und langen Arbeitszeiten zu profitieren. Andere Länder Lateinamerikas wie Brasilien, Chile oder Panama waren deshalb bei der Armutsbekämpfung deutlich erfolgreicher.Der Fortschritt ist vor allem vier Maßnahmen geschuldet: erstens den sozialen Transferprogrammen, die Sheinbaums Mentor, Parteifreund und Vorgänger Andrés Manuel López Obrador ab 2018 einführte. Zweitens der Gewerkschaftsfreiheit in der Industrie, die auf Druck der US-Demokraten in den überarbeiteten Freihandelsvertrag (T-MEC) aufgenommen wurde, der 2020 in Kraft trat. Diese Klausel beendete die Ära der korrupten, unternehmerfreundlichen Gewerkschaftsverbände und führte erstmals zu seriösen Tarifverhandlungen mit deutlichen Lohnsteigerungen. Drittens der strikten gesetzlichen Regulierung des Outsourcings, das zuvor bei Unternehmen eine beliebte Methode war, um Sozialabgaben zu umgehen, Löhne zu drücken und Arbeitnehmer jederzeit entlassen zu können. Viertens der Erhöhung des Mindestlohns, der in den vergangenen sechs Jahren um 151 Prozent gestiegen ist. Mexiko hat sich damit von einem Niedriglohnland ins lateinamerikanische Mittelfeld vorgearbeitet. Bemerkenswert ist, dass dies während einer Phase wirtschaftlicher Stagnation gelang – und ohne dass die Inflation außer Kontrolle geriet, wie viele Unternehmer stets gewarnt hatten.Diese Zahlen erklären zum Großteil die anhaltende Popularität Sheinbaums und ihrer linksnationalistischen Morena-Partei. Es ist ein beeindruckend schneller Rückgang – aber nicht beispiellos in der Geschichte. Ähnlich durchschlagende Erfolge erzielten Mitte der 2000er Jahre auch die linken Regierungen in Venezuela, Ecuador, Bolivien und Brasilien. Doch nur in Brasilien gelang eine Konsolidierung. In den anderen Ländern sind die Fortschritte mittlerweile aufgrund wirtschaftlicher und politischer Fehlentscheidungen verpufft. Will Mexiko diesem Schicksal entgehen, sind dringend Kurskorrekturen nötig.Mexiko hat sich von einem Niedriglohnland ins lateinamerikanische Mittelfeld vorgearbeitet.Die vielleicht wichtigste Erkenntnis aus den Erfahrungen dieser Länder lautet: Achtung, Konsumfalle! Die Erhöhung der Kaufkraft durch Transferleistungen oder Lohnerhöhungen steigert zwar unmittelbar die Konsumausgaben der Haushalte, vermittelt ein subjektives Gefühl von mehr Wohlstand und kurbelt die Inlandsnachfrage an – ein willkommener volkswirtschaftlicher Nebeneffekt in einem zunehmend schwierigen internationalen Umfeld. Doch dieser Aufstieg in die untere Mittelschicht bleibt prekär, wenn er nicht von strategischen Entscheidungen der Sozialhilfeempfänger – etwa Risikorücklagen oder privaten Investitionen in Bildung – sowie von strukturellen Wirtschaftsreformen begleitet wird, die den sozialen Aufstieg absichern. Das zeigt sich deutlich in Venezuela und Bolivien, wo heute wieder große Teile der Bevölkerung in die Armut zurückgefallen sind. An welchen Stellen muss Mexiko ansetzen, um diesen Fehler nicht zu wiederholen?Ein erstes Problem ist unzureichende Kontrolle und Fokussierung der Sozialprogramme. Nach Angaben von María Amparo Casar von der NGO Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad erhielten 2018 noch rund 80 Prozent der ärmsten Haushalte Sozialhilfe, heute sind es nur noch 58 Prozent. Zugleich beziehen fünf Prozent der begünstigten Familien gleich mehrere Leistungen – etwa Renten, Stipendien oder Hilfen für Landwirte und alleinerziehende Mütter – und verschlingen damit 20 Prozent der staatlichen Ressourcen. „Die Sozialprogramme erreichen die Allerärmsten nicht, obwohl sich ihre Summe vervierfacht hat“, warnt Amparo Casar.Das zeigen auch die offiziellen Statistiken. Demnach können sich in den ärmsten, indigener geprägten Bundesstaaten Chiapas, Oaxaca und Guerrero zwischen 50 und 60 Prozent der Bevölkerung von ihrem Lohn nicht einmal den kompletten Grundnahrungsmittelkorb leisten. Diese Fehler zu korrigieren, wäre leicht möglich. Es gibt dafür zahlreiche weltweit erprobte Methoden und in Mexiko genügend Experten, die bei der Umsetzung und Kontrolle helfen könnten – vorausgesetzt, der politische Wille ist vorhanden, wirklich Armut zu bekämpfen und nicht nur Klientelpolitik zu betreiben.Ein zweites Problem ist die hohe Informalität des Arbeitsmarktes. In einem formellen Arbeitsverhältnis mit minimaler sozialer Absicherung arbeiten nur 36 Prozent der Bevölkerung. Der Rest ist im Schwarzmarkt tätig, zahlt keine Steuern und hat keinen Anspruch auf Sozialversicherung. Die Informalität ist eine strukturelle Armutsfalle. Sie zu bekämpfen, ist jedoch deutlich komplexer als die Kontrolle der Sozialprogramme. Denn vom Schwarzmarkt profitieren mächtige politisch-wirtschaftlich-kriminelle Netzwerke. Informalität prägt den Alltag im Handel – etwa auf Straßen- und Bauernmärkten –, im Bau, in der Landwirtschaft, bei Produktpiraterie und im Handwerk. Sie findet sich aber ebenso in Industrie, Dienstleistungen und Bergbau. Die Bekämpfung des Schwarzmarktes ist nicht nur ein ordnungspolitisches und wirtschaftliches Problem, sondern auch sicherheitspolitisch heikel. Sie erfordert daher ein Bündel verschiedener Maßnahmen, mit wirtschaftlichen Anreizen ebenso wie Sanktionen, und die enge Koordination vieler staatlicher Stellen.Ohne Versicherung wird jeder Krankheitsfall in der Familie zum Armutsrisiko.Ein drittes Problem betrifft die Bildungs- und die Gesundheitspolitik. Diese beiden Bereiche sind grundlegende Pfeiler, um mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Ohne Versicherung wird jeder Krankheitsfall in der Familie zum Armutsrisiko, und ohne Bildung gibt es keine Chancengleichheit – soziale Mobilität wird dadurch erheblich erschwert. Doch an beide Pfeiler haben die Morena-Regierungen die neoliberale Kettensäge angesetzt – unter dem Vorwand der Korruptionsbekämpfung. Heute haben 44 Millionen Mexikanerinnen und Mexikaner keine Krankenversicherung, und jedes Jahr brechen fast eine Million Schülerinnen und Schüler sowie Studierende ihre Ausbildung ab. Zudem verfügen 15 von 100 Kindern nicht über eine ihrem Alter entsprechende Schulbildung.Es ist die Folge politischer Launen und persönlicher Abrechnungen. 2018 löste López Obrador die von seinen „neoliberalen Vorgängern“ geschaffene Volksversicherung auf, über die 50 Millionen informell arbeitende Mexikanerinnen und Mexikaner krankenversichert waren. Gleichzeitig wurden die Haushaltsmittel der Pflichtkrankenversicherung für Arbeiter und Angestellte gekürzt. Seither sind Medikamente knapp und fehlen teils monatelang – ein Todesurteil etwa für Krebspatienten. Eigentlich ausgerottete Krankheiten wie Keuchhusten und Masern breiten sich wieder aus, weil weniger als die Hälfte der Kinder unter zwei Jahren vollständig geimpft ist.Diese Entwicklung treibt die Menschen in die Arme privater Gesundheitsdienstleister. Mexikanische Familien geben heute fast doppelt so viel Geld für Gesundheit aus wie noch vor sechs Jahren. Dabei ist der mexikanische Staat ohnehin knausrig, wenn es um die Gesundheit der Bevölkerung geht: Laut der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) liegt Mexiko bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Gesundheit nur auf Platz 19 von 24 Ländern der Region – und das mitten in einer Epidemie von Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck.Bei der Bildung sieht es ähnlich aus. Die Regierung hat zwar Stipendienprogramme aufgelegt, doch diese werden nicht nach strengen akademischen oder sozialen Kriterien vergeben, sondern populistisch nach dem Gießkannenprinzip. Internationale Evaluierungen wie die Teilnahme an der Pisa-Studie wurden eingestellt. Eine Reform zur Professionalisierung der Lehrerschaft, die die Vorgängerregierung eingeführt hatte, wurde rückgängig gemacht – so sicherte sich López Obrador den politischen Rückhalt der korrupten, aber einflussreichen Lehrergewerkschaft. Gleichzeitig wurden Kinderkrippen und Frauenhäuser geschlossen und der Bildungshaushalt um 26 Prozent gekürzt. Darunter leidet die Qualität. Vor allem sozial benachteiligte Kinder, etwa von alleinerziehenden Müttern, haben heute weniger Chancen als früher, rechtzeitig und gezielt gefördert zu werden.Noch immer beenden viel zu wenige Jugendliche ihre Ausbildung.Noch immer beenden viel zu wenige Jugendliche ihre Ausbildung. Das größte Problem liegt in der Sekundarstufe II mit einer Abbrecherquote von rund 30,9 Prozent sowie in der technischen Berufsausbildung, die von zwei Dritteln der Jugendlichen nicht abgeschlossen wird. Dies ist ein erhebliches Hindernis bei der Überwindung von Armut und sozialer Ungleichheit – und ein gefundenes Fressen für die Kartelle, die in dieser Gruppe jugendlicher Schulabbrecher einen Großteil ihres Nachwuchses rekrutieren.Ein viertes Problem sind die Staatsfinanzen, die zur Finanzierung der Sozialprogramme herangezogen werden. Im ersten Jahr seiner Amtszeit gab Andrés Manuel López Obrador 15 Milliarden US-Dollar für direkte Transferleistungen aus. Im Sheinbaums Haushalt für 2025 sind dafür bereits 40 Milliarden US-Dollar vorgesehen – und das in einem Umfeld steigender Staatsverschuldung, wirtschaftlicher Stagnation und geopolitischer Unsicherheit. Das Geld, das in zunehmend ineffiziente Sozialprogramme fließt, fehlt nicht nur in Bildung und Gesundheit, sondern auch bei staatlichen Investitionen in Infrastruktur, die in den vergangenen acht Jahren stark zurückgefahren wurden.Ein viertes Problem sind die Staatsfinanzen, die zur Finanzierung der Sozialprogramme herhalten müssen. Im ersten Jahr seiner Amtszeit, gab Andrés Manuel López Obrador 15 Milliarden US-Dollar für direkte Transferleistungen aus. Im Haushalt von 2025 von Sheinbaum sind dafür schon 40 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Allerdings in einem Umfeld steigender Staatsverschuldung, wirtschaftlicher Stagnation und geopolitischer Unsicherheit. Das Geld, das in immer ineffizientere Sozialprogramme fliesst, fehlt nicht nur in Bildung und Gesundheit, sondern auch bei den staatlichen Investitionen in Infrastruktur, die in den vergangenen acht Jahren stark gelitten haben.Die Steuerlast in Mexiko ist im weltweiten Vergleich mit 14 Prozent des Bruttoinlandsproduktes noch immer sehr niedrig und beruht vor allem auf indirekten Steuern wie der Mehrwertsteuer, die regressiv sind und die ärmste Bevölkerung deutlich mehr belasten als die reichste. An eine Steuerreform wagten sich bislang weder López Obrador noch Sheinbaum. Bisher konnten sie das übertünchen durch eine effizientere Steuerbehörde, die zahlreiche Schlupflöcher schloss und die unsägliche Praxis der Steueramnestien beendete. Doch diese Taktik ist erschöpft. Sheinbaum steht vor dem Dilemma, ob sie nun doch eine Steuerreform angeht und die Reichen des Landes zur Kasse bittet, ob sie Sozialleistungen kürzt oder die Staatsfinanzen weiter belastet mit der Gefahr einer Wirtschaftskrise. Egal, wofür sie sich entscheidet. Alle drei Optionen könnten den bislang in Mexiko marginalen rechtspopulistischen und libertären Strömungen Aufwind geben. Weiter zum vollständigen Artikel bei IPG Journal
Quelle: IPG Journal