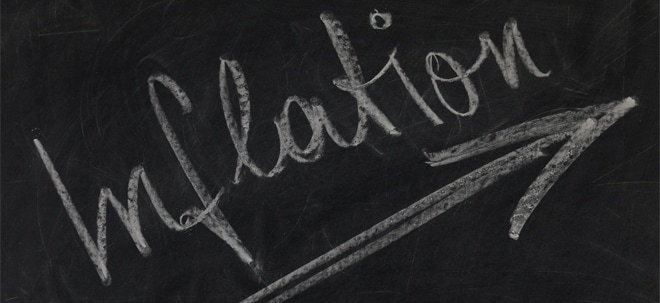Italienische Banken: Renzis Balanceakt

Die Probleme im italienischen Bankensystem gewinnen im aktuellen Kontext an Brisanz. Welche Herausforderung die Sanierung des Bankensektors sowohl wirtschaftlich als auch politisch bedeutet.
von Patrick Krizan, Gastautor für Euro am Sonntag
Der EBA-Stresstest hat viele Marktteilnehmer in ihren Befürchtungen um die Stabilität des italienischen Bankensektors bestätigt. Die Eigenkapitalsituation der meisten Institute, insbesondere der traditionsreichen Monte dei Paschi di Siena, ist durch hohe Belastungen aus notleidenden Krediten stark angespannt. In den kommenden Monaten dürften daher weitreichende Kapitalmaßnahmen notwendig werden. Manche sehen in der Schwäche des italienischen Bankensektors bereits den Auslöser einer neuen systemischen Eurokrise - wir halten diese Befürchtungen aber für übertrieben. Zum einen sind die Probleme der italienischen Banken nicht neu, sondern eine verschleppte Folge der vorigen Krise. Zum anderen sind die Turbulenzen im italienischen Bankensektor für die Eurozone aktuell nicht systemisch.
Zwar birgt die Verflechtung der italienischen Banken mit ihren europäischen Partnern durchaus die Gefahr einer Ansteckung, der Eurozone stehen inzwischen aber schlagkräftige Instrumente zur Krisenbekämpfung zur Verfügung, die, flankiert von einem erwartet entschlossenen Handeln der Europäischen Zentralbank EZB, eine krisenhafte Ausbreitung rasch unterbinden dürften. Auch die Entwicklung der Risikoprämie italienischer Staatsanleihen gegenüber der deutschen Benchmark deutet aktuell nicht auf ein Übergreifen der Bankenrisiken auf die Bonitätseinschätzung Italiens hin. Die Sanierung des Bankensektors stellt die Regierung in Rom jedoch vor Herausforderungen. Sie muss dabei einen zweifachen Balanceakt meistern: politisch und wirtschaftlich.
Die politische Herausforderung besteht darin, das Bail-in-Verfahren der europäischen Bankenrichtlinie BRRD zu respektieren, und andererseits die heimischen Halter von Bankanleihen zu schonen. Für viele italienische Haushalte könnte ein weitreichender Bail-in empfindliche Vermögensverluste bedeuten. Satte 38 Prozent der italienischen Bankanleihen (231 Milliarden Euro) werden von heimischen Privatanlegern gehalten (EU-Durchschnitt: drei Prozent). Angesichts des Referendums zur Senatsreform im Oktober, an dessen Ausgang Premier Renzi die Zukunft seiner Regierung geknüpft hat, wäre ein Bail-in politisch daher schwer verkraftbar, vor allem bei den zuletzt knappen Umfragen. Ob und in welcher Form der Bail-in tatsächlich zur Anwendung kommt, wird dann Gegenstand von Verhandlungen mit der EU-Kommission sein.
Zwischen Konjunkturdynamik und Schuldenquote
Die wirtschaftliche Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Konjunkturdynamik und Schuldenquote zu finden. Die makroökonomische Situation Italiens bleibt angespannt. Im Gegensatz zur Eurozone liegt die reale Wirtschaftsleistung noch immer weit unter dem Vorkrisenniveau von 2007. Der Abstand ist mit acht Prozentpunkten sogar deutlich höher als in Spanien oder Portugal. Diese schwache Wirtschaftsentwicklung ist einer der Gründe für den hohen Anteil notleidender Kredite im italienischen Bankensystem. Eine positive Konjunkturdynamik ist daher eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Sanierung der Bankenlandschaft. Zwar wuchs das italienische reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahr nach dreijähriger Rezession wieder um 0,6 Prozent, die Konjunktur bleibt aber fragil.Wir erwarten dieses und nächstes Jahr Wachstumsraten klar unter jenen der Eurozone (1,1 und 1,2 Prozent pro Jahr real). Sollte die Bankensanierung mit weitreichendem Bail-in einhergehen, könnten die privaten Haushalte als Reaktion auf die Vermögensverluste aus den Bankanleihen ihren Konsum zurückfahren. Damit wäre die wichtigste Stütze der zarten Konjunkturdynamik geschwächt. Einen regelrechten Einbruch erwarten wir für diesen Fall dennoch nicht. Schließlich basiert die gestiegene Konsumneigung primär auf der quantitativen und qualitativen Verbesserung des Arbeitsmarkts. Grundsätzlich birgt unserer Ansicht nach ein Bail-in kurzfristig mehr Abwärtsrisiken für das italienische Wachstum als ein Bail-out.
Ein Bail-out wiederum würde den Staatshaushalt belasten. Der Kapitalbedarf der italienischen Banken wird auf bis zu 50 Milliarden Euro geschätzt, was drei Prozent des italienischen BIP entspricht. Sollte dieser Bedarf rein aus öffentlichen Mitteln gedeckt werden, würde die Staatsverschuldung 2016 auf 136 Prozent des BIP ansteigen. Diese Zusatzbelastung würde aber nicht unmittelbar zu einer untragbaren budgetären Situation führen. Eine Schuldenaufnahme von 50 Milliarden Euro würde beim aktuellen impliziten Zinssatz der Staatsschulden von etwa drei Prozent eine zusätzliche jährliche Zinsbelastung von 0,1 Prozent des BIP verursachen. Dank der günstigen Nachfragesituation durch die Anleihekäufe der EZB könnte Italien diese Summe wahrscheinlich sogar mit recht langen Laufzeiten aufnehmen, sodass selbst bei steigenden Zinsen die Budgetbelastung dauerhaft beherrschbar bliebe. Zudem weist Italien seit 2011 einen klaren Primärüberschuss (Ausgaben ohne Zinsen) um die zwei Prozent des BIP aus. Diese Ausgaben des Staates ohne Zinsen sind somit gut auf die Einnahmesituation abgestimmt.
Sanierung via Kapitalaufnahme und
Verkauf der faulen Kredite
Die ersten von den Banken vorgelegten Sanierungspläne (etwa Monte dei Paschi di Siena) scheinen allein auf die Kapitalaufnahme an den Finanzmärkten und den Verkauf fauler Kredite zu setzen. Die Vollzugsrisiken sind hier aber erheblich. Das Szenario einer tiefgreifenden Sanierung des italienischen Bankensektors bleibt daher aktuell. In diesem Fall erwarten wir eine rasche Kompromisslösung zwischen EU-Kommission und der italienischen Regierung. Denkbar wäre ein abgeschwächtes Bail-in, bei dem nachrangige Bankanleihen für institutionelle Anleger geschnitten, Privatanleger aber geschützt oder entschädigt werden. Tatsächlich sind nur 13 Prozent der von Privatanlegern gehaltenen italienischen Bankanleihen nachrangig. Sollte sich der Kompromiss näher am Bail-out bewegen, wäre dies zwar für die Regierung leichter durchsetzbar, könnte allerdings bei den Marktteilnehmern zu einer Neubewertung der Rückkopplungsgefahr zwischen Bank- und Länderrisiken führen. Zuletzt erwiesen sich Bankenrisiken für die Risikoprämien der Euroländer nicht mehr als erklärend. Mit einer zum Bail-out tendierenden Kompromisslösung könnte sich dies wieder ändern und in den Risikoprämien der Euroländer zur deutschen Benchmark niederschlagen.
Kurzvita
Patrick Krizan studierte an der Universität St. Gallen und der Sciences Po Paris. Seit 2015 ist er Analyst mit Schwerpunkt Staatsanleihen bei Raiffeisen Research - der Research-Einheit der Raiffeisen Bank International in Wien.
Davor war er unter anderem als Analyst für das französische Finanzministerium und die Genfer Privatbank Lombard Odier tätig.
Weitere News
Bildquellen: Raiffeisen Research, federicophoto / Shutterstock.com