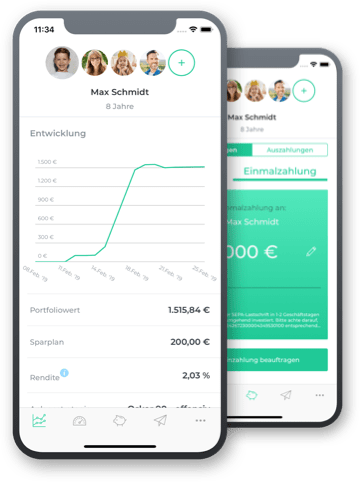Was dir niemand über Aktien-Recherche erzählt: Das Geheimnis der Profis
Während die meisten Privatanleger sich auf KGV und Umsatzzahlen verlassen, nutzen professionelle Investoren eine völlig andere Analysemethodik. Der Unterschied liegt nicht in besseren Tools, sondern im systematischen Verständnis von Unsicherheit, Geschäftsmodellen und versteckten Risiken.
Die Illusion der einfachen Kennzahlen
Wenn du eine Aktie recherchierst, schaust du wahrscheinlich zuerst auf dem Finanzportal deines Vertrauens vorbei. Dort findest du das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), den Umsatz, vielleicht noch die Dividendenrendite. Diese Zahlen vermitteln ein Gefühl von Sicherheit – schließlich sind es harte Fakten, oder?
Die ernüchternde Wahrheit: Professionelle Investoren betrachten diese Kennzahlen als Ausgangspunkt, nicht als Ziel. Die eigentliche Arbeit beginnt dort, wo die meisten Privatanleger aufhören. Denn zwischen dem ausgewiesenen Gewinn und der tatsächlichen Qualität eines Unternehmens können Welten liegen.
Der entscheidende Unterschied in der Denkweise: Privatanleger fokussieren sich auf den Preis und seine kurzfristige Entwicklung. Profis analysieren den Wert – und der entsteht aus einer Kombination von Faktoren, die sich nicht in einer einzelnen Kennzahl ausdrücken lassen.
Cashflow statt Gewinn: Der König der Kennzahlen
Das Nettoeinkommen ist die Zahl, die in den Schlagzeilen landet. Doch diese Größe kann durch buchhalterische Spielräume erheblich verzerrt werden. Der Free Cashflow (FCF) – also der Geldfluss, der nach allen notwendigen Investitionen übrig bleibt – gilt unter Profis als aussagekräftigerer Indikator für die finanzielle Gesundheit.
Ein Beispiel: Ein Unternehmen meldet einen Gewinn von 100 Millionen Euro. Gleichzeitig steigen die Forderungen gegenüber Kunden um 30 Millionen, weil großzügigere Zahlungsziele gewährt wurden. Der ausgewiesene Gewinn ist da, aber das Geld ist es nicht. Der Free Cashflow würde diese Diskrepanz sichtbar machen.
Besonders aufschlussreich ist die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Investitionen: Maintenance CAPEX beschreibt die Ausgaben, die notwendig sind, um das Geschäft am Laufen zu halten – etwa die Erneuerung von Maschinen. Growth CAPEX hingegen fließt in die Expansion. Nur wenn du diese Komponenten trennst, erkennst du, wie viel Geld das Unternehmen wirklich nachhaltig erwirtschaftet.
Die Qualität der Einnahmen lässt sich auch durch die Analyse von Accruals bewerten – das sind periodengerechte Abgrenzungen, die den Gewinn vom tatsächlichen Geldfluss abkoppeln. Steigen die Accruals über mehrere Quartale stark an, könnte das auf aggressive Bilanzierungspraktiken hindeuten, bei denen Umsätze vorzeitig erfasst oder Kosten in die Zukunft verschoben werden.
Die versteckten Schulden in der Bilanz
Die Verschuldung eines Unternehmens scheint auf den ersten Blick einfach ablesbar: Du schaust auf die Bilanz, addierst die kurzfristigen und langfristigen Verbindlichkeiten – fertig. Doch diese Rechnung greift zu kurz.
Seit der Einführung von IFRS 16 müssen zwar die meisten Leasingverträge in der Bilanz erscheinen, doch es gibt weiterhin Verpflichtungen, die nicht sofort ins Auge springen. Pensionslasten etwa können erheblich sein, insbesondere bei traditionellen Industrieunternehmen. Die tatsächliche Belastung hängt von Annahmen über Zinssätze und Lebenserwartung ab – Faktoren, die sich ändern können.
Noch schwieriger zu greifen sind kontingente Verbindlichkeiten: laufende Rechtsstreitigkeiten, Garantiezusagen oder potenzielle Umweltlasten. Diese Posten tauchen oft nur in den Fußnoten des Geschäftsberichts auf, können aber im Ernstfall zu erheblichen Zahlungen führen.
Auch die Struktur der Verschuldung spielt eine Rolle. Ein Unternehmen mit Anleihen, die in den nächsten zwei Jahren fällig werden, steht unter Refinanzierungsdruck – besonders problematisch in einem steigenden Zinsumfeld. Die Fälligkeitsprofile und Covenants (Kreditvereinbarungen, die bestimmte Finanzkennzahlen vorschreiben) geben Aufschluss darüber, wie viel Spielraum das Management tatsächlich hat.
Profitabilität richtig messen: ROIC und die Dupont-Formel
Die Frage, ob ein Unternehmen profitabel ist, lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Entscheidend ist, ob das eingesetzte Kapital eine Rendite erzielt, die über den Kapitalkosten liegt – also über dem, was Investoren anderswo verdienen könnten.
Der Return on Invested Capital (ROIC) zeigt, wie effizient ein Unternehmen sein gebundenes Kapital nutzt. Liegt der ROIC über den Weighted Average Cost of Capital (WACC) – den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten –, schafft das Unternehmen Wert. Liegt er darunter, wird Wert vernichtet, selbst wenn ein buchhalterischer Gewinn ausgewiesen wird.
Der Return on Equity (ROE), also die Eigenkapitalrendite, ist eine weitere wichtige Kennzahl. Doch auch hier lohnt sich ein tieferer Blick: Die Dupont-Analyse zerlegt den ROE in drei Komponenten – die Gewinnmarge, den Kapitalumschlag und den Verschuldungsgrad. Ein hoher ROE kann auf operative Stärke hindeuten, aber auch auf eine hohe Verschuldung, die das Risiko erhöht.
Ein weiterer operativer Indikator ist der Cash Conversion Cycle: Er misst, wie lange es dauert, bis ein investierter Euro wieder als Bargeld zurückfließt. Je kürzer dieser Zyklus, desto effizienter arbeitet das Unternehmen. Ein plötzlicher Anstieg könnte auf Probleme bei der Forderungseinziehung oder beim Lagerumschlag hindeuten.
Der Wettbewerbsvorteil: Was ist ein echter Moat?
Warren Buffett spricht häufig von einem „Moat“ – einem Burggraben, der ein Unternehmen vor Wettbewerbern schützt. Doch nicht jeder vermeintliche Vorteil ist von Dauer. Die Herausforderung besteht darin, nachhaltige Wettbewerbsvorteile von temporären Marktpositionen zu unterscheiden.
Ein echter Moat zeigt sich in einer von fünf Formen:
- Immaterielle Vermögenswerte: Starke Marken (wie Coca-Cola oder Apple), Patente oder regulatorische Genehmigungen schaffen Preissetzungsmacht und Kundenloyalität.
- Wechselkosten: Wenn Kunden hohe Kosten oder Aufwände hätten, zu einem Konkurrenten zu wechseln, bleibt das Unternehmen weniger angreifbar. Softwarelösungen, die tief in Unternehmensprozesse integriert sind, sind ein Beispiel.
- Netzwerkeffekte: Je mehr Nutzer eine Plattform hat, desto wertvoller wird sie für jeden einzelnen. Soziale Netzwerke oder Zahlungsdienstleister profitieren von dieser Dynamik.
- Kostenvorteile: Unternehmen mit Größenvorteilen können Produkte günstiger herstellen als kleinere Wettbewerber. Dieser Vorteil ist besonders stabil in kapitalintensiven Industrien.
- Effiziente Skalierung: Geschäftsmodelle, bei denen die Grenzkosten für zusätzliche Kunden nahezu null sind – etwa bei Softwareunternehmen – ermöglichen überproportionales Wachstum.
Doch selbst ein starker Moat ist nichts wert, wenn die Branchendynamik gegen das Unternehmen arbeitet. Porters Five Forces – ein Framework zur Analyse der Wettbewerbskräfte – hilft dabei, das Umfeld zu verstehen: Wie stark ist die Verhandlungsmacht der Lieferanten und Kunden? Wie hoch ist die Bedrohung durch neue Wettbewerber oder Substitute? Wie intensiv ist die Rivalität in der Branche?
Ein Unternehmen in einem reifen, konsolidierten Markt mit hohen Eintrittsbarrieren steht völlig anders da als ein Startup in einem fragmentierten Wachstumsmarkt. Der Branchenlebenszyklus – ob sich die Industrie in der Wachstums-, Reife- oder Disruptionsphase befindet – beeinflusst die langfristigen Aussichten erheblich.
Das Management: Der unterschätzte Erfolgsfaktor
Ein großartiges Geschäftsmodell kann durch schlechtes Management ruiniert werden. Umgekehrt kann exzellentes Management auch in schwierigen Branchen Wert schaffen. Doch wie bewertet man die Qualität des Managements?
Ein wichtiger Anhaltspunkt sind die Anreizstrukturen. Erhält der CEO den Großteil seiner Vergütung als kurzfristige Boni, die an das Quartalsergebnis geknüpft sind? Oder ist die Vergütung an langfristige Kennzahlen wie den Total Shareholder Return über mehrere Jahre gebunden? Besitzt das Management signifikante eigene Anteile am Unternehmen – hat es also „Skin in the Game“?
Die Kapitalallokation ist ein weiterer Gradmesser. Wie hat das Management in der Vergangenheit mit überschüssigem Kapital umgegangen? Wurden sinnvolle Akquisitionen getätigt, die Synergien geschaffen haben – oder wurden überteuerte Übernahmen durchgeführt, die Wert vernichtet haben? Werden Aktienrückkäufe zu günstigen Bewertungen durchgeführt, oder kauft das Unternehmen die eigenen Aktien nahe ihrem Allzeithoch zurück?
Die Qualität der Kommunikation gibt ebenfalls Aufschluss. Liest sich der Geschäftsbericht klar und ehrlich, oder ist er voller Marketing-Phrasen und Ausflüchte? Wie geht das Management mit schlechten Nachrichten um – werden Probleme offen angesprochen oder schöngeredet? Die jährlichen Shareholder Letters – insbesondere die von CEOs verfassten – können hier sehr aufschlussreich sein.
Auch die Unternehmenskultur und Governance spielen eine Rolle. Wie unabhängig ist der Aufsichtsrat? Gibt es Interessenkonflikte? Welche Erfolgsbilanzen haben die Führungskräfte in ihren vorherigen Positionen vorzuweisen?
Unsicherheit quantifizieren: Szenario-Analyse statt Punktschätzung
Viele Anleger versuchen, den „richtigen“ fairen Wert einer Aktie zu berechnen. Doch die Zukunft ist fundamental unsicher. Professionelle Investoren arbeiten daher nicht mit einzelnen Punktschätzungen, sondern mit Szenarien und Wahrscheinlichkeitsverteilungen.
Ein strukturierter Ansatz besteht darin, drei plausible Szenarien zu entwickeln:
- Best Case: Was passiert, wenn alles optimal läuft – das Produkt wird ein Hit, der Markt wächst schneller als erwartet, Wettbewerber bleiben zurück?
- Base Case: Das wahrscheinlichste Szenario basierend auf historischen Daten und realistischen Annahmen.
- Worst Case: Was passiert, wenn mehrere Risiken gleichzeitig eintreten – etwa eine Rezession, ein Produktrückruf oder der Eintritt eines starken neuen Wettbewerbers?
Eine Sensitivitätsanalyse zeigt, wie stark der faire Wert auf Veränderungen einzelner Variablen reagiert. Wie empfindlich ist die Bewertung gegenüber Zinssätzen, Wachstumsannahmen oder Gewinnmargen? Diese Analyse macht deutlich, welche Annahmen besonders kritisch sind.
Noch robuster ist eine Monte-Carlo-Simulation, bei der tausende Szenarien mit zufällig variierten Eingangsvariablen durchgespielt werden. Das Ergebnis ist keine einzelne Zahl, sondern eine Verteilung möglicher Werte mit zugehörigen Wahrscheinlichkeiten.
Die Killer-Risiken: Systematische Risikokatalogisierung
Neben der Bewertung müssen Investoren die Risiken systematisch erfassen, die ein Investment gefährden könnten. Eine strukturierte Kategorisierung hilft dabei:
- Operationelle Risiken: Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten oder Großkunden, Produktqualitätsprobleme, Lieferkettenunterbrechungen.
- Strategische Risiken: Technologische Disruption durch neue Konkurrenten, Obsoleszenz des Geschäftsmodells, Fehlentscheidungen bei der Produktentwicklung.
- Finanzielle Risiken: Hohe Verschuldung in einem steigenden Zinsumfeld, Währungsrisiken bei international tätigen Unternehmen, Liquiditätsengpässe.
- Externe Risiken: Regulatorische Änderungen, geopolitische Spannungen, makroökonomische Abhängigkeiten wie Rohstoffpreise.
- ESG-Risiken: Umweltauflagen, soziale Kontroversen, Governance-Schwächen – Faktoren, die zunehmend materielle finanzielle Auswirkungen haben können.
Die Identifikation dieser Risiken ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, ihre potenzielle Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewerten – und zu überlegen, welche Szenarien zum Totalverlust führen könnten.
Der Margin of Safety: Die Sicherheitsmarge als Schutzmechanismus
Selbst nach gründlicher Analyse bleibt Unsicherheit. Profis bauen daher einen Margin of Safety – eine Sicherheitsmarge – in ihre Bewertung ein. Das bedeutet: Sie kaufen nur dann, wenn der Marktpreis deutlich unter dem geschätzten fairen Wert liegt.
Wie groß diese Marge sein sollte, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Bewertungsbasiert: Je unsicherer die Bewertungsannahmen, desto größer sollte der Abschlag sein. Bei einem stabilen Konsumgüterunternehmen mit vorhersehbaren Cashflows mag ein Abschlag von 20 Prozent ausreichen. Bei einem zyklischen oder hoch verschuldeten Unternehmen könnte ein Abschlag von 40 Prozent oder mehr angemessen sein.
- Qualitätsbasiert: Unternehmen mit starken Moats, stabilen Cashflows und exzellentem Management erfordern eine geringere Sicherheitsmarge als Unternehmen in umkämpften Märkten mit schwacher Profitabilität.
- Opportunitätskosten: Die Frage ist nicht nur, ob eine Aktie günstig ist, sondern ob das Kapital hier besser angelegt ist als in der nächstbesten Alternative.
Die richtigen Informationsquellen: Jenseits von Finanzportalen
Die Tiefe der Analyse steht und fällt mit der Qualität der genutzten Informationen. Während die meisten Privatanleger auf aggregierte Daten aus Finanzportalen zurückgreifen, gehen Profis direkt zu den Primärquellen:
- Primärquellen: Der 10-K (Jahresbericht bei der US-Börsenaufsicht SEC) und der 10-Q (Quartalsbericht) enthalten die vollständigen Finanzdaten, Risikofaktoren und Management-Diskussionen. Das Proxy Statement gibt Aufschluss über Vorstandsvergütungen und Governance-Strukturen. Earnings Call Transcripts – die Mitschriften der Quartalskonferenzen – zeigen, wie das Management auf kritische Fragen reagiert.
- Branchenquellen: Fachzeitschriften, Berichte von Branchenverbänden und die Filings der Wettbewerber helfen, den Kontext zu verstehen. Auch Aussagen von Kunden oder Lieferanten können wertvoll sein.
- Alternative Daten: Satellitendaten über Parkplatzauslastungen bei Einzelhändlern, Web Scraping von Preisdaten, aggregierte Kreditkartentransaktionen – solche Datenquellen werden zunehmend auch von kleineren Investoren genutzt. Auch Plattformen wie Glassdoor, auf denen Mitarbeiter ihre Arbeitgeber bewerten, können Hinweise auf die Unternehmenskultur geben.
Der iterative Research-Prozess: Von der These zur Investitionsentscheidung
Profi-Recherche ist kein linearer Prozess, bei dem man oben anfängt und unten herauskommt. Es ist ein iterativer Zyklus aus Hypothesenbildung, Überprüfung und Anpassung.
Der Prozess beginnt mit einer initialen Investment-Thesis: einer prägnanten Aussage darüber, warum eine Aktie attraktiv sein könnte. Diese Thesis basiert auf ersten Erkenntnissen – etwa einem unterbewerteten Geschäftsmodell, einem unterschätzten Wachstumspotenzial oder einer temporären Marktschwäche.
Der entscheidende nächste Schritt ist die aktive Suche nach Disconfirming Evidence – nach Beweisen, die die These widerlegen könnten. Das ist der Gegenpol zum weit verbreiteten Confirmation Bias, bei dem wir unbewusst nur nach Informationen suchen, die unsere Meinung bestätigen. Ein strukturierter Ansatz könnte darin bestehen, gezielt nach kritischen Presseberichten, negativen Analystenmeinungen oder Schwachstellen im Geschäftsmodell zu suchen.
Nach dieser Phase folgt die Synthese: Das Abwägen aller gesammelten Faktoren. Eine hilfreiche Technik ist die Pre-Mortem-Analyse: Man stellt sich vor, das Investment sei in zwei Jahren gescheitert, und arbeitet rückwärts die Gründe heraus. Welche Annahmen haben sich als falsch erwiesen? Welche Risiken sind eingetreten?
Auch nach der Investitionsentscheidung ist der Prozess nicht abgeschlossen. Das Post-Investment-Monitoring stellt sicher, dass die ursprünglichen Annahmen weiterhin gültig sind. Welche Entwicklungen würden die Investment-Thesis gefährden? Welche Kennzahlen müssen regelmäßig überprüft werden? Welche Ereignisse wären ein klarer Ausstiegstrigger?
Praktische Umsetzung: Wo anfangen?
Die Fülle an Analysemöglichkeiten kann überwältigend wirken. Doch auch professionelle Investoren haben begrenzte Zeit. Der Schlüssel liegt in der Priorisierung.
Wenn du einen 10-K-Bericht liest, beginne mit den Abschnitten „Risk Factors“ und „Management’s Discussion and Analysis (MD&A)“. Hier erklärt das Unternehmen selbst, was schiefgehen könnte und wie es die finanzielle Lage einschätzt. Diese Abschnitte sind oft aufschlussreicher als die nackten Zahlen.
Für die Bewertung der Finanzqualität konzentriere dich auf die Cashflow-Rechnung. Vergleiche den operativen Cashflow mit dem Nettoeinkommen über mehrere Jahre. Große Abweichungen sind ein Warnsignal. Prüfe, ob die Kapitalausgaben steigen oder sinken – und ob diese Entwicklung zur Unternehmensstrategie passt.
Bei der Moat-Analyse stelle dir konkrete Fragen: Was würde ein neuer Wettbewerber benötigen, um in diesen Markt einzutreten? Warum kaufen Kunden bei diesem Unternehmen und nicht bei der Konkurrenz? Wie hat sich die Marktposition in den letzten fünf Jahren entwickelt?
Für die Management-Bewertung schau dir die historische Kapitalallokation an: Wie viel Geld wurde für Übernahmen ausgegeben, und haben diese Übernahmen Wert geschaffen? Vergleiche die gezahlten Preise mit den Marktbewertungen zum Zeitpunkt des Kaufs. Lies die Shareholder Letters der letzten Jahre und achte darauf, ob das Management seine Versprechen eingehalten hat.
Die zwei Seiten der Medaille: Bull- und Bear-These
Eine objektive Analyse erfordert, dass du beide Seiten einer Investmentgeschichte verstehst. Für jede Aktie lassen sich sowohl optimistische als auch pessimistische Argumente formulieren.
Die Bull-These könnte etwa auf einem unterschätzten Wachstumspotenzial, einer bevorstehenden Margenerholung oder einem unterschätzten Moat basieren. Vielleicht wird das Unternehmen von einer makroökonomischen Entwicklung profitieren – etwa steigende Nachfrage nach Elektromobilität oder Infrastrukturinvestitionen.
Die Bear-These hingegen könnte auf strukturellen Problemen basieren: schrumpfende Margen durch intensiveren Wettbewerb, technologische Disruption, eine hohe Schuldenlast in einem steigenden Zinsumfeld oder regulatorische Risiken. Vielleicht ist das Geschäftsmodell zyklischer als es scheint, und die aktuellen Gewinne liegen über dem langfristigen Durchschnitt.
Die gleichwertige Darstellung beider Perspektiven hilft nicht nur dabei, Confirmation Bias zu vermeiden. Sie zwingt dich auch, die wichtigsten Annahmen deiner Investment-Thesis zu identifizieren – und damit die Faktoren, die du besonders genau beobachten musst.
Fazit: Der Weg zum tieferen Verständnis
Die Kluft zwischen oberflächlicher und tiefer Aktienanalyse ist größer, als die meisten Privatanleger vermuten. Während Kennzahlen wie das KGV oder die Dividendenrendite schnell verfügbar sind, liegen die wirklich entscheidenden Informationen oft tiefer verborgen.
Die wesentlichen Unterschiede in der professionellen Analysemethodik lassen sich in vier Kernbereichen zusammenfassen:
- Finanzielle Tiefe: Der Free Cashflow ist aussagekräftiger als das Nettoeinkommen. Die Unterscheidung zwischen Maintenance- und Growth-CAPEX, die Analyse von Accruals und die Identifikation versteckter Verbindlichkeiten trennen substanzielle von scheinbarer Profitabilität.
- Qualitative Faktoren: Ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil – der Moat – ist wichtiger als kurzfristige Quartalsergebnisse. Die Qualität des Managements, gemessen an Anreizstrukturen, Kapitalallokation und Transparenz, beeinflusst den langfristigen Unternehmenserfolg entscheidend.
- Risikodenken: Professionelle Investoren arbeiten nicht mit Punktschätzungen, sondern mit Szenarien und Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Eine systematische Risikokatalogisierung und ein angemessener Margin of Safety schützen vor den unvermeidlichen Fehleinschätzungen.
- Prozessdisziplin: Der Research-Prozess ist iterativ und selbstkritisch. Die aktive Suche nach Gegenargumenten, die Nutzung von Primärquellen und ein kontinuierliches Post-Investment-Monitoring sind Teil einer systematischen Methodik.
Diese Form der Analyse erfordert Zeit und Geduld. Sie steht im Widerspruch zur kurzfristigen Orientierung der Märkte und zur Verlockung schneller Gewinne. Doch genau darin liegt ihr Wert: In der Fähigkeit, Ursachen zu verstehen statt nur Auswirkungen zu beobachten, Unsicherheit zu quantifizieren statt sie zu ignorieren, und Qualität über Quantität zu stellen.
Der Anspruch ist nicht, bei jedem Investment richtig zu liegen. Das ist unmöglich. Der Anspruch ist, einen Prozess zu etablieren, der über viele Entscheidungen hinweg einen systematischen Vorteil schafft – durch tieferes Verständnis, rigorosere Analyse und die Disziplin, nur dann zu investieren, wenn die Evidenz überzeugend ist.
Wer bereit ist, diese zusätzliche Arbeit zu leisten, verschafft sich einen Vorteil, den keine noch so ausgefeilte Chart-Technik oder kein kurzfristiger Tipp ersetzen kann: das Verständnis dafür, was ein Unternehmen wirklich wertvoll macht – und was diesen Wert gefährden könnte.
Disclaimer: Die in diesem Artikel enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations-, Bildungs- und Marketingzwecken ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Die Inhalte stellen keine Anlageberatung, Anlagestrategieempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die Informationen berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele und finanzielle Situation des Lesers. Jede Anlageentscheidung sollte eigenverantwortlich getroffen und sorgfältig geprüft werden. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters eingeholt werden. Der Handel mit Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ist mit hohen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die durch die Umsetzung der in diesem Artikel genannten Informationen entstehen.
1Hinweis zu ZERO: finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.
*Hinweis zu Affiliate-Links: Unsere Ratgeber-Artikel sind objektiv und unabhängig erstellt, wobei mit Sternchen gekennzeichnete Links zur Finanzierung der kostenlosen Inhalte dienen. Die Vergütung aus diesen Links hat keinen Einfluss auf unsere Inhalte.

Aktien, ETFs, Derivate, Kryptos und mehr - jetzt für 0 Euro pro Trade handeln (zzgl. marktüblicher Spreads)!

Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.