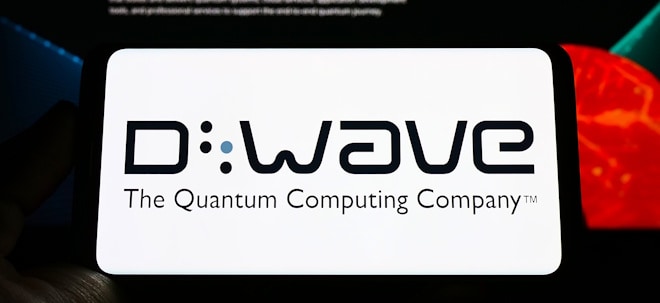Gehirnforscher Spitzer: „Nur Schimpansen sind immer rational“
Der Psychiater Manfred Spitzer erklärt, was bei einem Börsencrash im Gehirn passiert und warum Börsenerfolge nur für kurze Zeit glücklich machen.
von Martin Blümel, €uro am Sonntag
Richtig lernen, vor allem schon im Kindesalter, ist das wichtigste Anliegen von Manfred Spitzer. Der Psychiater und Neurologe hat aber auch erforscht, was im Gehirn bei Börsengeschäften und beim Gedanken an Geld vor sich geht. Bekannt ist Spitzer durch seine populärwissenschaftlichen Bücher und über 100 TV-Folgen zum Thema „Geist und Gehirn“, die derzeit bei BR-alpha zu sehen sind.
€uro am Sonntag: Die Finanzmärkte sind seit einigen Jahren geprägt von „Boom and Bust“, von Euphorie, Blasenbildung und Finanzkrisen. Kann die Gehirnforschung so komplexe Phänomene erklären?
Manfred Spitzer: Ich glaube nicht, dass die Gehirnforschung das kann, was den Ökonomen bislang nicht gelungen ist. Aber der relativ junge Wissenschaftszweig der Neuroökonomie könnte hilfreich sein. Beispiel: Die Ökonomie geht nach wie vor davon aus, dass der Mensch letztlich rational und egoistisch ist und dass damit an alles gedacht sei. Die „unsichtbare Hand des Markts“ erledigt den Rest. Daten aus der experimentellen Ökonomie und der Neuroökonomie zeigen jedoch, dass die meisten Menschen ein Bedürfnis nach Fairness haben, welches stärker ist als der rationale Egoist in ihnen.
Das widerspräche ja gängigen Wirtschaftstheorien.
Spitzer: Ja, man konnte sogar zeigen, dass es den Homo oeconomicus, so wie ihn die Ökonomie prinzipiell fordert, weltweit gar nicht gibt. Allenfalls der Schimpanse verhält sich immer rational und egoistisch. Das haben Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Anthropologie in Leipzig gezeigt. Menschen sind anders, ich möchte sagen: besser als ihr Ruf.
Trotzdem gehen immer wieder zu viele Menschen zur gleichen Zeit zu viele Risiken ein.
Sicherlich. Aber wenn jeder für das Risiko, das er eingeht, auch entsprechend haften müsste, dann würde das System ganz natürlich gegensteuern. Das Problem der Finanzkrise war aber, dass einflussreiche Bankmanager wussten, dass sie letztlich kein Risiko tragen, weil ihre Institution zu groß ist, als dass sie versagen könnte. Dieses Argument „too big to fail“ gilt im Grunde genommen noch heute. Wieder wird viel spekuliert, und wieder tragen diejenigen, die das verantworten, das Risiko nicht. Dem muss man entgegensteuern, und zwar politisch.
Was passiert im Gehirn, wenn mir riskante Geschäfte Gewinne einbringen?
Es ist so, dass unerwartete Gewinne unser Glückserleben aktivieren – das gilt wahrscheinlich auch für Börsengewinne. Etwas Unerwartetes, das zugleich positiv ist, triggert eine ganze Kaskade von Vorgängen im Gehirn, die letztlich jedoch nicht auf Glücklichsein abzielen, sondern auf Lernen. Dummerweise wird an der Börse bei Gewinnen kaum dazugelernt, denn die Anzahl der zu lernenden Variablen, die in einen Börsenkurs eingehen, ist einfach zu groß, um hier von wirklichem Wissen sprechen zu können. Letztlich ist die Börse so eine Art Glücksspiel. Die Neurowissenschaft hat jede Menge Einsichten über Glücksspiel gewonnen und zeigen können, wie sehr dieses pathologische Verhalten in die Nähe der Sucht zu rücken ist, weil ganz ähnliche neuronale Mechanismen dafür verantwortlich sind. Glücksgefühle an der Börse sind also pathologische Glücksgefühle, keine echten.
Kann man also an der Börse nichts dazulernen?
Doch. Im Grunde genommen setzen Privatanleger die Lernmechanismen ihres Gehirns selbst auf: Sie lernen durch Verfolgung der Börsennachrichten, welche Kurse steigen. Wenn sie es dann gelernt haben, investieren sie, aber oft ist es dann schon zu spät. Soll man aber deswegen diesen Menschen raten, auf Lernen zu verzichten? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, dass wir zu einer sinnvollen Börse ohne Glücksspiel zurückkommen sollten.
Das ist schwer bei der Vielzahl an Einflussfaktoren.
Ja. Letztlich geht es um Vertrauen. Untersuchungen mithilfe von Magnetresonanztomographen haben gezeigt, dass sich Vertrauen bei Investoren dadurch langsam entwickelt, dass sie zunächst kleine Investitionen vornehmen und dann schauen, was zurückkommt. Generell gilt, dass Vertrauensbildung ebenfalls ein Lernprozess ist. Man lernt, den anderen immer besser einzuschätzen. Deswegen kann man Vertrauen auch nicht künstlich herstellen, man muss einfach nur vertrauenswürdig sein, man muss vorhersehbar sein in seinen Entscheidungen. Wenn ich weiß, wie sich jemand morgen entscheiden wird, kann ich meine eigene Entscheidung auch heute schon darauf bauen.
Das Gehirn arbeitet ja mit Botenstoffen. Braucht es davon besonders viele oder wenige, um an der Börse Erfolg zu haben?
Lassen Sie mich mit einer Gegenfrage antworten: Braucht Ihr Computer besonders viel oder wenig Strom, um zu funktionieren?
Gleich viel ...
Ja. Nicht die Menge an Elektrizität ist wichtig, sondern die unterschiedlichen Muster winzig kleiner elektrischer Impulse, die von der Hardware verarbeitet werden. Nicht anders ist es beim Gehirn. Es geht darum, wie die Botenstoffe miteinander interagieren und welche Informationen so verarbeitet werden. Nun gibt es im Gehirn einzelne Subsysteme, Module, von denen manche mit besonderen Botenstoffen arbeiten. So spielt etwa Dopamin bei Risikobereitschaft eine Rolle, Serotonin bei Depression, Angst und Furcht, aber auch bei Nahrungsaufnahme, Schlafverhalten, allgemeiner Wachheit.
Kann man das steuern oder beeinflussen?
Vor mehr als zehn Jahren gab es die Theorie, dass der Dotcom-Börsencrash nur deshalb so schwerwiegend ausfiel, weil so viele Börsenmakler Mittel einnahmen, welche die Aufnahme von Serotonin hemmten und so die Risikobereitschaft steigerten und die Angst verminderten. Letztlich ist das – so plausibel es klingen mag – aber Spekulation.
Was passiert im Gehirn bei einem Börsencrash?
Treten negative unerwartete Ereignisse auf, die man nicht unter Kontrolle hat, kommt es zur Stressreaktion. Die läuft automatisch ab, schaltet alle unwesentlichen Körperfunktionen ab, wie Verdauung, Immunabwehr, Reproduktion und Regeneration, und schaltet auf Höchstleistung für Flucht oder Kampf. Dies ist kurzfristig sehr sinnvoll, mobilisiert Energie und hat uns in unserer Vergangenheit sicherlich oft das Leben gerettet. Dauerstress jedoch führt zu Verdauungsproblemen, zu Magengeschwüren. Die dauernde Unterdrückung der Immunabwehr führt zu mehr Infektionskrankheiten sowie zu Krebs. Die dauernde Unterdrückung der Reproduktion führt zu Libidoverlust und Impotenz und das dauernde Antreiben zu Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems. Im Kopf bewirkt chronischer Stress das Absterben von Nervenzellen, die man zum vernünftigen Entscheiden braucht.
Ungesund. Aber vielleicht entschädigt Börsenerfolg?
Wissen Sie, Geld verdienen oder ausgeben macht nicht glücklich, weil die Glücksgefühle nur von kurzer Dauer sind. Unterm Strich sorgt Geldausgeben sogar für negative Gefühle, da man den Krempel ja noch bezahlen und hierfür Arbeit verrichten muss. Zudem muss man sich um die angeschafften Dinge kümmern, abstauben, putzen, Rost entfernen, pflegen, warten. Und all das bereitet uns kein Glück, sondern eher Kopfzerbrechen. Derjenige, der in Glück investieren will, sollte nicht in Sachen, sondern in Erlebnisse investieren. Machen Sie eine Reise, am besten mit lieben Menschen zusammen. Das macht langfristig glücklich. Erinnerungen brauchen keine Wartung und unser Gedächtnis sorgt dafür, dass sie umso rosiger werden, je länger sie zurückliegen.
Unter einigen Ökonomen ist gerade die These populär: Je ungleicher Einkommen verteilt ist, desto schlechter geht es dem Land. Was sagen Sie dazu?
Auch wenn diese These umstritten ist, halte ich den Grundgedanken für richtig. Ungleichheit bewirkt Stress und damit ungesunde Lebensweisen. Zudem hat nicht zuletzt die Gehirnforschung herausgefunden, dass Menschen ein Bedürfnis haben, Gleichheit in einer Gruppe herzustellen. Ich sagte es eingangs bereits: Menschen sind besser als ihr Ruf. Sie streben nach Fairness, Vertrauen, Gemeinschaft mit ähnlich Denkenden. Der Mensch ist nicht Wolf unter Wölfen.
Mehr im Blog: "Blümel staunt"