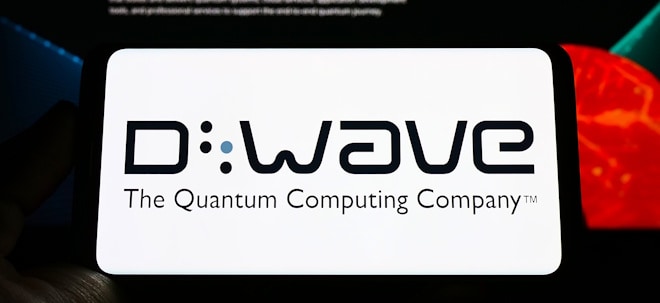Notenbanker Dombret: "Der Cocktail ist nicht ungefährlich"

Der Bundesbankvorstand für Finanzaufsicht, Andreas Dombret, über Lehren aus der Finanzkrise, die Risiken der EZB-Politik für die Notenbank und die gefährliche Renditejagd an den Börsen.
von Alexander Sturm, Euro am Sonntag
EZB, IWF, G 20, G 7, SSM, BIZ, FSB, BCBS: Andreas Dombret kommt aus dem Repräsentieren der Bundesbank in internationalen Gremien kaum heraus. Als Vorstand für Banken und Finanzaufsicht ist sein Terminkalender von früh bis spät durchgetaktet. Seit der Finanzkrise überziehen Regulierer Banken mit unzähligen Vorschriften. Da will die Bundesbank in Person von Dombret, der einst Investmentbanker war, natürlich mitreden.
Doch auch am Hauptsitz der Bundesbank in Frankfurt-Ginnheim kehrt kaum Ruhe ein: Jüngst verkündete sie einen Jahresgewinn von 2,95 Milliarden Euro - fast 40 Prozent weniger als 2013. Ausgerechnet die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), gegen die sich die Bundesbank stets gewehrt hat, lässt die Zinsen und damit auch ihre Zinserträge sinken. Zu allem Übel muss die Bundesbank auch noch Teile des Staatsanleihen-Kaufprogramms der EZB umsetzen. Dieses wiederum bläht die Bewertungen von Aktien und Anleihen an den Börsen immer weiter auf. Genug Gesprächsstoff für Andreas Dombret.
€uro am Sonntag: Seit dem Beschluss der EZB, Staatsanleihen zu kaufen, steigen Aktien rasant. Der DAX knackt Rekord um Rekord. Sehen Sie schon eine Aktienblase?
Andreas Dombret: Wir erleben eine Kombination aus niedrigen Zinsen, hoher Liquidität, niedriger Inflation und relativ geringen Kursschwankungen. Dieser Cocktail ist nicht ungefährlich. Er kann zum Beispiel zu einer "Jagd nach Rendite" führen. Um noch ein wenig Rendite zu erzielen, legen Investoren riskanter an - etwa in risikoreiche Unternehmensanleihen niedriger Qualität. In der Vergangenheit hat man gesehen, dass in einem solchen Umfeld Preisblasen entstehen können, zum Beispiel am Aktien- oder Immobilienmarkt. Zudem können niedrige Schwankungen ein falsches Gefühl der Sicherheit hervorrufen. Manche Investoren verleitet das dazu, auf die Absicherung ihrer Anlagen teilweise oder komplett zu verzichten.
Als Risiko sehen Experten steigende Zinsen in den USA. Jüngst hat die amerikanische Notenbank Fed Investoren darauf eingestellt, dass sie die Zinsen anheben wird. Viele erwarten Turbulenzen bei Anleihen, da bei steigenden Zinsen die Kurse alter Bonds fallen dürften. Wie sehen Sie das?
Ich kommentiere die Geldpolitik anderer Notenbanken nicht. Eins ist aber klar: Ändern sich Zinsen abrupt und stark, entstehen Risiken. Große Investoren sichern sich dagegen ab. Für Kleinanleger ist das schwieriger. Es gilt für alle Währungsräume, dass Zinsen nicht nur fallen können, sondern irgendwann wieder steigen werden - auch hierzulande. Man sollte sich nicht zu sehr an ein bestimmtes Zinsniveau gewöhnen.
Auch die Bundesbank ist an den Anleihemärkten engagiert. Sie kauft im Auftrag der EZB bis 2016 Bundesanleihen für rund 190 Milliarden Euro. Einige Papiere haben aber eine negative Rendite. Wer kommt für Verluste auf?
Die nationalen Notenbanken im Euroraum setzen das EZB-Programm um, indem sie Anleihen aus ihren jeweiligen Heimatländern kaufen. Dabei nehmen sie Ausfallrisiken auf die eigene Bilanz. Die Bundesbank kauft Bundesanleihen, aber auch Papiere von Förderbanken. Wir können Papiere mit negativer Rendite erwerben, sofern diese nicht unterhalb des Einlagensatzes der EZB von derzeit minus 0,2 Prozent liegt. Bundesanleihen haben ja aktuell bis zu einer Laufzeit von sieben Jahren eine negative Rendite. Es gibt aber auch Papiere mit längerer Laufzeit.
Die Verluste könnten laut Medienberichten im mittleren dreistelligen Millionenbereich liegen. Steht die Bundesbank im Fall von Verlusten dafür gerade?
Der EZB-Rat hat noch nicht abschließend geregelt, wie die monetären Einkommen aus dem Ankaufprogramm für Staatsanleihen geteilt werden sollen.
Findet die Bundesbank denn genug Bundesanleihen für ihre Käufe? Gut verzinste Altanleihen dürfte kaum jemand verkaufen ...
Meine Kollegen erwarten, dass einige Halter von Staatsanleihen aus geschäftspolitischen oder regulatorischen Gründen nicht zum Verkauf bereit sind - zum Beispiel Versicherungen oder Pensionsfonds. Andere dürften ihre Bestände bereitwilliger anbieten. Bisher konnten wir die Käufe jedenfalls problemlos tätigen.
Als Bundesbankvorstand sind Sie für Banken und Finanzaufsicht verantwortlich. Zuletzt haben Sie dafür plädiert, Staatsanleihen künftig nicht mehr als risikofreie Anlagen zu behandeln. Warum?
Bislang müssen Banken für Staatsanleihen kaum oder gar kein Eigenkapital vorhalten. Dabei hat die Eurokrise gezeigt, dass die Papiere beileibe nicht risikofrei sind. Die enge Verbindung von Banken und Staaten hat die Krise verschärft. Haben Banken viele Staatsanleihen in den Büchern und kommen Staaten in Schwierigkeiten, wackeln auch Banken. Das Bewusstsein, dass Staatsanleihen in Bankbilanzen nicht risikofrei sind, ist immens gestiegen.
Wann könnte es zur Neubehandlung von Staatsanleihen kommen?
Der Baseler Ausschuss hat angekündigt, die bisherige Praxis zu überprüfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir bis zum Ende meiner Amtszeit in rund drei Jahren zu einer ersten Übereinkunft kommen können. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass dann die Umsetzung vollzogen ist.
Strengere Vorschriften für Staatsanleihen würde die Finanzierung von Staaten in Europa verteuern. Welche Folgen hätte das?
Klar ist, dass schärfere Eigenkapitalvorschriften für Staatsanleihen längere Übergangsfristen brauchen. Vermutlich würden neben Banken als Käufer von Staatsanleihen andere Marktteilnehmer treten. In jedem Fall würde eine Unterlegung von Staatsanleihen mit Eigenkapital Anreize für Banken schaffen, sich noch genauer zu überlegen, in was sie investieren, und ihre Bilanz weniger zu hebeln. Auch Staaten müssten solider wirtschaften: Je niedriger ihre Risiken sind, desto geringer sind die Risikoaufschläge für ihre Anleihen, und desto niedriger wäre auch die Eigenkapitalunterlegung bei Banken. Dann könnten sich Staaten wiederum leichter finanzieren.
Was haben die Aufseher weltweit seit der Finanzkrise erreicht? Was betrachten Sie als größten Erfolg?
Es wurden nicht nur die Eigenkapitalanforderungen für Banken verschärft und damit die Menge und die Qualität des Eigenkapitals im System deutlich erhöht. Wir haben auch erstmals globale Mindestanforderungen an die Liquidität gestellt. In der Finanzkrise war es ja in erster Linie fehlende Liquidität und nicht unbedingt fehlendes Eigenkapital, das Banken scheitern ließ. Außerdem hat sich das Risikobewusstsein im Bankensektor verändert. Dinge, die vor der Finanzkrise als Kavaliersdelikt galten, werden heute viel kritischer gesehen. Früher herrschte oft der Gedanke, dass alles erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist. Das wird von der Öffentlichkeit nicht mehr akzeptiert. Es ist ein grundsätzlicher Kulturwandel im Gange.
Glauben Sie, dass der Kulturwandel der Banken abgeschlossen ist?
Nein, am Kulturwandel müssen die Banken weiterarbeiten - zumindest einzelne Institute, denn viele Banken haben sich ja immer vernünftig verhalten. Man sollte nicht alle Banken in einen Topf werfen. Wir brauchen starke Banken für unsere Volkswirtschaft. Die Branche leidet darunter, dass es innerhalb einiger weniger Institute einzelne schwarze Schafe gab und möglicherweise auch noch gibt. Eine Minderheit hat es so übertrieben, dass die ganze Branche in Verruf geraten ist.
Zuletzt haben Sie sich gegen den Ruf von Bankern nach einer Regulierungspause gewehrt. Warum?
Natürlich ist die klassische Reaktion der Banken: Regulierung ja, aber bitte nicht bei mir. Als ich noch Banker war, habe ich Regulierung zwar eingesehen, Regulierer aber nicht immer umarmt. Ich will die Kosten der Banken für die Regulierung gar nicht kleinreden. Man darf aber aus Bankensicht die eigenen Kosten nicht isoliert betrachten. Die Kosten, die die Finanzkrise der Gesellschaft aufgebürdet hat, waren massiv. Wir müssen die großen, offenen Themen der Regulierung abschließen, bevor wir uns eine Pause gönnen können.
Woran hakt es denn noch?
Leider gibt es noch keine endgültige Lösung für das "Too big to fail"-Problem. Wenn sehr große Banken scheitern, kann das einen Dominoeffekt auslösen und das ganze Finanzsystem in Schieflage geraten. 2014 haben die G 20-Staaten beschlossen, höhere Anforderungen an das verlustabsorbierende Kapital systemrelevanter Banken zu stellen - gerade für den Fall einer Abwicklung.
Was bringt das?
Das soll dafür sorgen, dass Eigentümer und Gläubiger der Banken haften und nicht der Steuerzahler. Dieses Thema müssen wir möglichst noch dieses Jahr abschließen. Zudem müssen Schattenbanken stärker beobachtet und gegebenenfalls mehr reguliert werden. Je strenger die Regulierung der Banken, desto größer der Anreiz, in weniger regulierte Bereiche auszuweichen. Hier muss noch viel geschehen. Sonst haben wir die Banken zwar sicherer gemacht, aber die Risiken nur in einen anderen Bereich des Finanzsystems verschoben. Und drittens fehlt noch eine angemessene Regulierung der Derivatemärkte. Diese drei Themen betreffen längst nicht alle deutschen Banken, aber mehr als eine.
Vom Investmentbanker zum Aufseher
Für einen Notenbanker hat Andreas Dombret, 55, eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich: Nach Bankkaufmannslehre und BWL-Studium machte er Karriere als Investmentbanker bei J P Morgan, Rothschild und Bank of America. Auch dank guter Kontakte in die Politik wechselte das CDU-Mitglied 2010 zur Bundesbank. Dort beaufsichtigt Dombret seine alte Zunft - was anfangs Misstrauen erregte. Heute gilt er wegen seiner starken öffentlichen Präsenz und zahllosen Posten in Aufsichtsgremien als Gesicht der Bundesbank nach Präsident Jens Weidmann.Weitere News
Bildquellen: iStockphoto, karuka / Shutterstock.com