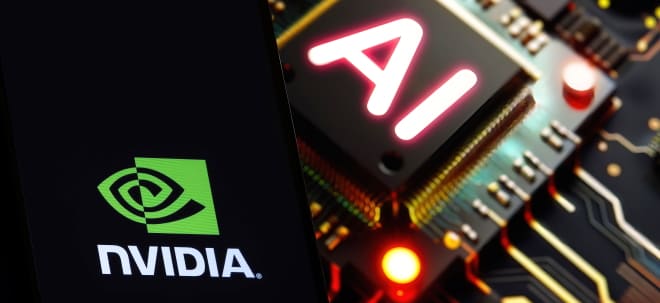Start-Stopp-Systeme im Auto: Wie sinnvoll ist die Technik wirklich?

Start-Stopp-Systeme sind in modernen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren weit verbreitet. Sie sollen den Kraftstoffverbrauch senken und die Umwelt entlasten, indem sie den Motor bei Stillstand automatisch abschalten. Doch wie effektiv ist diese Technik wirklich?
Funktionsweise
Start-Stopp-Systeme erkennen, wenn ein Fahrzeug steht, und schalten dann den Motor aus - etwa im Leerlauf an einer roten Ampel. Sobald der Fahrer die Kupplung tritt oder das Bremspedal löst (je nach Fahrzeugtyp), startet der Motor automatisch neu. Die Technik dahinter variiert laut der Autozeitschrift Auto Motor und Sport: In herkömmlichen Systemen übernimmt der verstärkte Anlasser den Neustart, bei modernen Mildhybrid-Systemen (MHEV) mit 48-Volt-Technologie kommt hingegen ein Startgenerator zum Einsatz. Dieser arbeitet schneller, leiser und versorgt gleichzeitig das Bordnetz mit Strom - etwa für Klimaanlage, Infotainment oder elektrische Servolenkung.
Kraftstoffersparnis und Umweltvorteile
Vor allem im dichten Stadtverkehr lassen sich durch die Start-Stopp-Automatik laut ADAC zwischen drei und 15 Prozent Kraftstoff einsparen - abhängig vom Fahrzeugmodell und dem individuellen Fahrstil. In der Praxis bedeutet das, wer viel im urbanen Raum unterwegs ist, kann von der Technologie finanziell profitieren. Hinzu kommt die Reduktion von CO2-Emissionen und eine spürbare Entlastung der Geräuschkulisse an Kreuzungen und in Stausituationen. Für Vielfahrer mit hohem Stadtanteil ist der Nutzen besonders ausgeprägt. "Sobald der Motor läuft, verbraucht er Kraftstoff, etwa 0,5 bis 1 Liter pro Stunde - auch wenn das Fahrzeug nicht fährt", erklärt Katharina Lucà, Unternehmenssprecherin des ADAC. "Daher: Motor aus, wenn die Leerlaufzeit voraussichtlich länger dauert! An Bahnübergängen ist das sogar vorgeschrieben."
Technische Grenzen und Voraussetzungen
Trotz aller Vorteile ist die Start-Stopp-Funktion nicht jederzeit aktiv. Die Elektronik überprüft laufend, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wird zum Beispiel zu viel Strom von der Klimaanlage oder Heizung benötigt, oder ist die Batterie nicht ausreichend geladen, bleibt der Motor in Betrieb. Auch kalte Außentemperaturen, geöffnete Türen oder nicht angelegte Gurte können den automatischen Stopp verhindern. Damit das System zuverlässig funktioniert, sind spezielle Batterien erforderlich, sogenannte AGM- oder EFB-Batterien, die auf häufige Startvorgänge ausgelegt sind, wie ein Beitrag des Hörfunkprogramms Bayern 1 erklärt.
Verschleiß und Wartung
Ein häufiges Argument gegen die Start-Stopp-Technik lautet, dass sie den Motor und Starter übermäßig belastet. Diese Sorge war vor allem in den Anfangsjahren der Technologie nicht unbegründet. Inzwischen sind Fahrzeuge jedoch mit verschleißfesteren Startern, robusteren Batterien und intelligenten Motorsteuerungen ausgestattet. So wird der Motor beispielsweise stets in einer idealen Position abgeschaltet, um den Wiederstart zu erleichtern. Bei sachgemäßer Nutzung ist der zusätzliche Verschleiß also minimal - vorausgesetzt, die Technik wird nicht manuell übersteuert oder bei Wartungen vernachlässigt.
Empfehlungen und rechtliche Hinweise
Viele Autofahrer empfinden die Funktion als störend - besonders, wenn der Motor an jeder Ampel ausgeht. Doch laut ADAC ist es nicht ratsam, die Start-Stopp-Automatik dauerhaft zu deaktivieren. Zum einen entfällt damit der beabsichtigte Spritspar-Effekt, zum anderen kann eine dauerhafte Abschaltung in bestimmten Fällen die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs gefährden. Wer also keine technischen Probleme mit dem System hat, sollte es lieber aktiviert lassen - sowohl aus ökonomischen als auch aus rechtlichen Gründen.
Redaktion finanzen.net
Weitere News
Bildquellen: Alexander Chaikin / Shutterstock.com, Krom1975 / Shutterstock.com