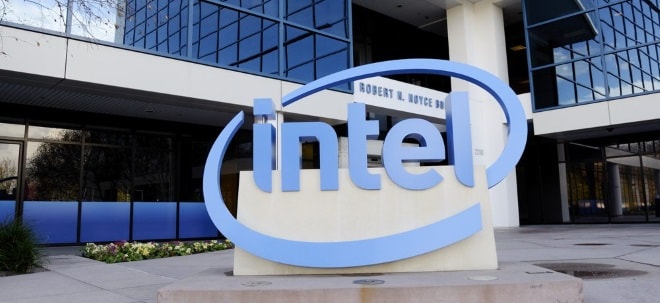Vorsicht Wohltäter: Die Tricks der Spendensammler
Geld für einen guten Zweck sammeln ist längst zum lukrativen Gewerbe mutiert. Doch nicht alle haben nur Gutes im Sinn. Wie Sie Abzocker erkennen.
Gutmenschen sind in der Minderheit. In den vergangenen zwölf Monaten gaben nur 39 Prozent der Bundesbürger über 14 Jahre freiwillig Geld für einen guten Zweck, so ein Ergebnis des „Deutschen Spendenmonitors 2009“, einer jährlichen Umfrage von TNS Infratest. 2008 spendeten noch 42 Prozent der Bundesbürger.Doch wer den Rückgang auf die Wirtschaftskrise schiebt, kommt in Erklärungsnot: Denn in den vergangenen zwölf Monaten wurden 2,9 Milliarden Euro gespendet, 100 Millionen mehr als vor Jahresfrist. Macht im Schnitt je Kopf 115 statt 102 Euro. Wie passt das zur Finanzkrise?
Liegen die Gründe für die Spendenverweigerung vielleicht woanders? Spenden sammeln – auf Neudeutsch Fundraising – ist längst ein Geschäft. Ein Geschäft mit Gefühlen. So lernen professionelle Spendensammler an der Fundraising Akademie in Frankfurt/Main, an Gefühl und Herz zu appellieren. Kein Wunder, dass rund ein Drittel des Spendenaufkommens in den Monaten November und Dezember fließt, wenn das Herz sowieso schon weit ist. Einzelne Organisationen nehmen in dieser Zeit fast die Hälfte ihrer Jahresspenden ein.
Was niemand erzählt: Auch Spenden ist ein Geschäft auf Provisionsbasis. Selbst seriöse Hilfswerke engagieren gut geschulte Spendensammler und Vermittler, die Dauerspender werben sollen. Häufig geht mehr als die Hälfte des ersten Jahresbeitrags als Provision an den Spendenspezialisten. „Das Geschäft ist oft eine Täuschung der Spender“, sagt ein Fundraiser aus dem Süden der Republik. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen: „Sonst kann ich mein Geschäft zusperren.“
Im Spendenbusiness gilt generell: Wer am stärksten auf die Tränendrüse drückt, bekommt das meiste. Sachliche Information verleitet nicht zum Spenden. Da bleiben Herz und Geldbörse verschlossen. Der Spendensammler wagte einmal den Versuch. Er initiierte zwei Kampagnen für eine Organisation, die einerseits Geld brauchte, andererseits sachlich informieren wollte. Die emotionale Kampagne brachte über 50 Prozent mehr an Spenden ein. „Von da an war es keine Frage mehr, wie die Kampagnen auszusehen hatten“, erzählt der Fundraiser. Dabei verzichtete er bei der gefühlvollen Kampagne sogar auf Postkarten mit fußgemalten Bildern oder personalisierten Absenderaufklebern mit dem Namen des angesprochenen Spenders. „Ganz kalt wird hier damit kalkuliert, den Spendern ein schlechtes Gewissen zu machen. Sie fühlen sich in der Pflicht zu spenden, weil ihnen ja sonst etwas von einer Organisation geschenkt würde, die auf Spenden angewiesen ist. Das hätte sicher noch mehr gebracht, doch solche Methoden halte ich nicht mehr für seriös.“
Genau damit haben auch potenzielle Spender inzwischen ein Problem. Welche Organisation ist seriös, welche nicht? Und woran macht man das fest? Am ehesten doch daran, ob dem Spender die unterstützten Projekte sinnvoll und lohnend erscheinen und ob sorgsam mit den Spenden umgegangen wird. Dabei ziehen nur die wenigsten in Zweifel, dass Geldbeschaffung auch Geld kostet. Die Frage ist nur, ob diese Kosten offengelegt werden, ob sie angemessen sind und ob sie im Einzelfall nicht reduziert werden können. Übrigens: Von den Spenden fließen – je nach Organisation – bis zu 35 Prozent und mehr in die Eigenfinanzierung. Das ist viel. Manchen auch zu viel.
Wer sicher sein will, dass „seine“ Spendenorganisation seriös arbeitet, sollte sie löchern. Wichtige Themenkomplexe: Ziele und Strategie, Organisationsstruktur, Vergütung der Mitarbeiter und Organe, Projektarbeit, Mittelverwendung, aussagefähige Bilanz mit Vorjahresvergleich und Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Kosten für Werbung, Spendenaufkommen, Verwaltungskosten.
Die Liste ließe sich leicht fortsetzen. Man kann es sich aber auch einfacher machen und prüfen, ob die Organisation das Spendensiegel des DZI hat. Das DZI - Deutsches Zentralinstitut für Soziale Fragen (www.dzi.de) überprüft überregionale, gemeinnützige Organisationen in Sachen Mittelbeschaffung, -verwendung, -kontrolle und Transparenz. Nur wer deren Anforderungen erfüllt, bekommt das DZI-Siegel. Derzeit tragen es 253 Organisationen. Auf Anfrage gibt das DZI Auskünfte über 2100 Spendensammler. Übrigens: Bei DZI-zertifizierten Wohltätern liegen die Ausgaben für Werbung und Verwaltung bei durchschnittlich 16 Prozent. Auch bei den Mitgliedsorganisationen des Deutschen Spendenrats (www.spendenrat.de) kann man in Sachen Seriosität ziemlich sicher sein.
Doch eine Zertifizierung macht eine Organisation nicht über jeden Zweifel erhaben. Auch das Kinderhilfswerk Unicef war mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet, bis 2008 das Siegel wegen falscher Angaben bei Provisionszahlungen für Spenden entzogen wurde. Den meisten Wohltätigkeitsgalas und Charity-Banketten müssten ebenfalls die Spendensiegel entzogen werden, wenn sie denn welche hätten. Denn damit ein attraktiver Event geschaffen werden kann, wird häufig ein immenser Aufwand betrieben. Während dabei die via TV aufbereitete Gala zu durchaus beachtlichen Spendensummen führen kann, sind normale Charity-Bankette oder Galas häufig nicht mal kostendeckend.
Aber wer weiß das schon. Die Wohltäter sind notorisch verschwiegen. Umsätze und Kassenlage der Wohlfahrtsimperien sind meist unbekannt. Und Vergleichsdaten darüber, wo effizient oder schludrig gearbeitet wird, gibt es kaum. Unter dem Siegel der Barmherzigkeit findet sich viel Intransparenz. Mangelnde Wirtschaftlichkeit ist nicht selten die Folge. Denn wer Gutes tut, ist vor Kritik auch in Sachen Wirtschaftlichkeit geschützt. Zumal die Wohltäter darauf verzichten, ihre Gewinne eigennützig zu verwenden. Zur Belohnung werden sie als gemeinnützig anerkannt. Wer dieses Gütesiegel hat, wird mit Privilegien ausgestattet. So zahlen Wohlfahrtsverbände weder Körperschafts-, Gewerbe- noch Erbschaftssteuer. Bei der Umsatzsteuer gibt es Vergünstigungen. Allein aus der Körperschaft- und Gewerbesteuer errechnet sich ein Steuervorteil von jährlich etwa 600 Millionen Euro. Zudem erhalten die Wohlfahrtsverbände Bußgelder und Lotterieerlöse. Das benachteiligt freie Selbsthilfegruppen und private Anbieter. Außerdem können Wohlfahrtsverbände nicht nur Ehrenamtliche und Freiwillige beschäftigen – eine Kostenentlastung von geschätzt zehn Milliarden Euro jährlich –, sie setzen auch in großem Stil Zivildienstleistende ein. Deren Kosten übernimmt die Dienststelle – sprich der Steuerzahler. Gegenüber der privaten Konkurrenz ein weiterer Vorteil.