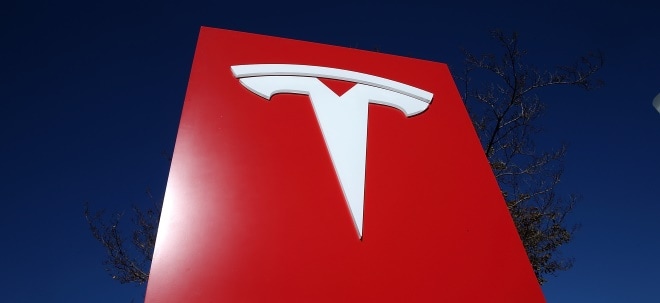Auf diese Heizquelle setzen die Deutschen zunehmend

In deutschen Neubauten ist die Wärmepumpe längst angekommen - doch ihr Siegeszug wirft Fragen und Ungleichgewichte auf. Wer sie einsetzt und warum, zeigt, wie tief die Energiewende in den Hochbau eingreift.
Wärmepumpe: Der neue Standard im Neubau
Laut Statistischem Bundesamt wurden 2024 in 69,4 Prozent der rund 76.100 neuen Wohngebäude Wärmepumpen zur primären Heizungsquelle installiert - ein Anstieg von etwa fünf Prozentpunkten gegenüber 2023. Besonders deutlich ist der Trend bei Ein- und Zweifamilienhäusern (74,1 Prozent), während Mehrfamilienhäuser mit 45,9 Prozent etwas zurückliegen.
Dahinter steckt ein politischer Rahmen: Seit Januar 2024 schreibt das neue Gebäudeenergiegesetz mindestens 65 Prozent erneuerbare Heizenergie im Neubau vor. Dank umfangreicher Fördertöpfe - teils bis zu 70 Prozent Zuschuss - steigt zudem die Nachfrage, wie Analysen von Geomap zeigen: Die klimafreundlichen Heizungsraten legten anhaltend zu.
Produktionseinbruch und Marktunsicherheiten
Trotz der starken Nachfrage sank die Wärmepumpenproduktion 2024 auf nur noch 162.400 Stück - ein Rückgang um 59 Prozent gegenüber 2023. Auch der Export schrumpfte deutlich. Dennoch wurde im ersten Quartal 2025 ein Absatzplus von 35 Prozent verzeichnet, wenn auch von einem niedrigen Niveau (ca. 62.000 Geräte).
Da die Industrie im vergangenen Jahr zusätzlich in Kapazitäten investiert hatte, entstanden überzählige Lagerbestände und Personal, berichtet die BWP. Ursachen sind laut Branchenberichten politische Unsicherheiten, schleppende kommunale Wärmepläne und fehlende Fachkräfte. Die IEA prognostiziert jedoch ein Absatzwachstum von rund 30 Prozent für 2025.
Herausforderungen im Gebäudebestand
Im Bestandsbau dominieren weiterhin fossile Heizsysteme: 54 Prozent der Gebäude heizen mit Gas, Öl; erneuerbare Heiztechnologien kommen nur bei rund zehn Prozent zum Einsatz. Dabei bleiben ambitionierte Ziele ausgebaut: Der ZVSHK meldet für 2024 rund 200.000 installierte Wärmepumpen - weit vom Ziel von 500.000 pro Jahr entfernt.
Hauptprobleme im Altbau sind hohe Modernisierungskosten, bürokratische Hindernisse und unklare Rückzahlungsmechanismen. Experten betonen, dass eine energetische Sanierung gekoppelt an den Wärmepumpeneinbau eine Kernstrategie sein muss, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Zudem bedeuten steigende Zinsen Hemmnisse im Finanzierungsprozess.
Effizienz, Kosten & Netzintegration
Wärmepumpen gelten als besonders effizient - Studien des IEA bestätigen, dass sie langfristig Heizkosten um rund 28 Prozent gegenüber Gas senken. Allerdings erfordern sie eine stabile Stromversorgung: Ein sauberer Energieträger-Mix und günstige Tarife sind Voraussetzung.
Zudem steigt der Druck auf bestehende Stromnetze. Dafür gibt es Modelle, die Wärmepumpen mit Solarstrom und Pufferspeichern koppeln; Studien zeigen, dass diese Kombination deutlich Netzlasten reduzieren kann. Unter dem Stichwort "Lastmanagement" könnten Wärmepumpen künftig sogar als flexible Netzstütze fungieren.
D. Maier / Redaktion finanzen.net
Weitere News
Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com